Quelle:
Die Zusammenstellung der Texte wurden im Original nachfolgenden KTBL-Seiten entnommen:
- KTBL.de: Tierwohl bewerten (externer Link)
- Eigenkontrolle_Tierwohl.pdf (externer Link)
- KTBL.de: Tierschutzindikatoren – Milchrinder (externer Link)
Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.V. (KTBL) https://www.ktbl.de/ (externer Link)
Tierwohl bewerten
In verschiedenen Projekten erarbeitet das KTBL gemeinsam mit einer Vielzahl von Partnern die Grundlagen dafür, wie sich Tierwohl auf einzelbetrieblicher Ebene erfassen und bewerten oder auf nationaler Ebene beschreiben lässt, und wie die Tiergerechtheit verschiedener Haltungsverfahren einzuordnen ist. Diese Quantifizierung stellt eine Voraussetzung für eine kontinuierliche Verbesserung der Tiergerechtheit und des Tierwohls dar (Quelle KTBL).
Seit 2014 sind Tierhalter und Tierhalterinnen gemäß Tierschutzgesetz zu einer betrieblichen Eigenkontrolle des Tierwohls verpflichtet. Mit dieser Gesetzesänderung wurden „Tierschutzindikatoren“ verstärkt ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt (Quelle KTBL).
Auf der entsprechenden Internetseite des KTBL finden sie hierzu zahlreiche Themen.
(externer Link)

Einen kleinen Auszug/ eine kleine Übersicht wollen wir Ihnen hier vorstellen:
Betriebliche Eigenkontrolle Tierwohl
Tierwohl im Stall – „Animal Welfare“ – ist ein Thema, das jeden Nutztierhalter betrifft. Es ist ein fester Bestandteil des Leitbilds der tierischen Produktion. Das Wohlergehen seiner Nutztiere ist jedem verantwortungsbewussten Tierhalter ein Anliegen. Darum ist eine selbstkritische Bestands-aufnahme im eigenen Betrieb sinnvoll. Nachfolgend sind die wichtigsten Informationen über eine Erfassung und Bewertung von Tierwohl, die gesetz-lichen Vorgaben und die Vorzüge einer betrieblichen Eigenkontrolle zusammengefasst und die KTBL-Praxisleitfäden „Tierschutzindikatoren“ be-schrieben.
Verantwortung Tierwohl
Wenn Tierwohl gemessen und im nächsten Schritt bewertet werden soll, muss klar sein, was „Tierwohl“ ist. Ganz pragmatisch ausgedrückt: Es geht um das Wohlbefinden des Tieres. Dies lässt sich an der Gesundheit, am Verhalten und an den Emotionen des Tieres festmachen. Das Tier soll gesund sein und wichtige arteigene Verhaltensweisen ausleben können, beispielsweise sich bewegen, ausweichen und ungestört ruhen können. Negative Emotionen wie Angst und Schmerz sollen vermieden werden.
Ist dies gewährleistet, kann von einer „guten Tierwohlsituation“ bzw. einer „tiergerechten Haltung“ ausgegangen werden (BMEL 2019).
„Tiergerechtheit“ beschreibt, in welchem Maß Umweltbedingungen dem Tier die Voraussetzungen zur Vermeidung von Schmerzen, Leiden und Schäden sowie zur Sicherung von Wohlbefinden bieten. Demgegenüber bezieht sich „Tierschutz“ auf die Aktivitäten des Menschen zum Schutz von Tieren und Tiergerechtheit.
Der entscheidende Faktor für Tierwohl ist der Mensch, der genau hinsieht. Als Tierhalter ist er verantwortlich für das Wohlergehen seiner Tiere und hat auch den größten Einfluss auf die tierische Leistung zur Sicherung seines Einkommens. Auch die Gesellschaft fordert von den Tierhaltern eine tier-gerechte Haltung ihrer Nutztiere, was ethisch legitim ist und von allen, die Tiere nutzen, ernst genommen werden sollte (Kunzmann 2015). Allerdings geht es darum, was mess- und prüfbar und nicht nur „gefühlt“ tiergerecht ist.
In den letzten Jahrzehnten wurde unter „tiergerechter Haltung“ meist verstanden, dass baulich-technische Anforderungen im Haltungssystem zu prüfen und einzuhalten sind, z. B. Mindestauslauffläche, -luftwechsel oder -troglänge. Heute kommt man von diesem reinen „Zollstock-Tierschutz“ immer mehr ab. Ein möglichst optimales Haltungssystem ist zwar grundlegende Voraussetzung für eine tiergerechte Nutztierhaltung, aber entscheidend ist, dass das Tier mit den gegebenen Rahmenbedingungen die eigenen unterschiedlichen Ansprüche befriedigen kann. Deshalb hat sich inzwischen der Ansatz durchgesetzt, dass die Folgen der Haltungsbedingungen und der Managementmaßnahmen des Tierhalters auf das Tier erfasst werden müssen. Denn stimmen Futter, Klimaführung oder Umgang des Halters mit den Tieren nicht, nutzt der beste Stallkomfort nichts.
Tierwohl lässt sich am besten an den Tieren selbst, ihrem Verhalten und ihrer Gesundheit erkennen:
Das Tier selbst rückt also ins Zentrum der Betrachtung und der Tierhalter ist am besten informiert, wenn er „tierbezogene“ Kenngrößen erhebt.
Wer muss eine betriebliche Eigenkontrolle durchführen?
Im Hinblick auf Tierwohl ist eine sachliche und faktenbasierte Überprüfung der Situation in den Tierbeständen erforderlich.
Diese Prüfung schärft den Blick des Tierhalters in Bezug auf das Tierwohl und hilft ggf. Betriebsblindheit zu vermeiden.
Eine solche betriebliche Schwachstellenanalyse kann dem Tierhalter helfen, grundlegende Risiken für das Tierwohl in seinem Betrieb frühzeitig zu erkennen und sein Management zu verbessern.

Außerdem bietet die betriebliche Eigenkontrolle die Chance, die polarisierende gesellschaftliche Diskussion zum Tierwohl in der Nutztierhaltung zu versachlichen. Der Gesetzgeber schreibt im Tierschutzgesetz § 11 Abs. 8 (TierSchG 2006) vor, dass jeder Nutztierhalter in einer betrieblichen Eigen-kontrolle „geeignete tierbezogene Merkmale (Tierschutzindikatoren)“ zu erheben und zu bewerten hat; die Regelung gilt seit 2014.
Die Eigenkontrolle kann und soll die gemäß Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (TierSchNutztV 2006, § 4 Abs. 1) vorgeschriebenen täglichen Tierkontrollen nicht ersetzen, kann diese aber ergänzen. Die Vorgabe des § 11 Abs. 8 (TierSchG 2006) enthält jedoch keine Verordnungsermächtigung zur Regelung von Inhalt, Umfang und Häufigkeit der betrieblichen Eigenkontrollen, d. h. genauere Vorgaben bzw. Ausführungsbestimmungen über das „Wie“ existieren auf Bundesebene nicht. Verantwortlich für die Kontrolle der Umsetzung sind jeweils die Tierschutzreferate der Länderregierungen mit ihren Amtsveterinären. Einzelne Bundesländer, wie z. B. Baden-Württemberg, Thüringen, Schleswig-Holstein, haben inzwischen Vorschläge zur Konkretisierung geeigneter Indikatoren für einzelne Tierarten erarbeitet.
KTBL-Aktivitäten
Um für Nutztierhalter praktikable Vorschläge zu erarbeiten, wie eine betriebliche Eigenkontrolle durchgeführt werden könnte, wurden vom KTBL 2014 und 2015 zwei Fachgespräche organisiert. Von rund 50 Experten aus Wissenschaft, Beratung, Verwaltung, Tierschutzverbänden und Praxis wurden Indikatoren aus anderen Systemen zusammengestellt, die sich für eine betriebliche Eigenkontrolle zur Beurteilung der Tierg-erechtheit gemäß § 11 Abs. 8 besonders eignen.
Es wurden Indikatoren ausgewählt, mit denen relevante Tierwohlprobleme in der Praxis identifiziert werden können. Die Anforderungen an die Indikatoren waren, dass sie hinreichend valide, also fachlich belastbar, und reliabel, also verlässlich bei Wiederholung, sind. Vor allem aber wurde auf die Praktikabilität geachtet, d. h., dass sie sich auf dem einzelnen Betrieb mit vertretbarem Aufwand erheben lassen
Tabelle 1:
Indikatoren zur Erfassung möglicher Tierschutzprobleme – Produktionsrichtung Milchkühe (Zapf et al. 2015, modifiziert nach Brinkmann et al. 2020)

So wurden bei der Auswahl bevorzugt im Betrieb bereits vorliegende Daten, z. B. aus der Milchleistungsprüfung, tierärztliche AuA-Belegen, HIT oder anderen Datenbanken, berücksichtigt, um den Erhebungs- und Dokumentationsaufwand zu minimieren. Zum Erkennen bestimmter Tierwohl-probleme ist trotzdem eine gezielte Datenerhebung im Stall „am Tier“ notwendig.
Das Ergebnis des Abstimmungsprozesses ist das vorliegende Set von Indikatoren, mit denen Tierhalter zuverlässig erfassen können, inwieweit in der Praxis besonders relevante Tierschutzprobleme auch in ihrem Tierbestand auftreten. Die empfohlenen Indikatoren sollten nach Möglichkeit zumindest bei den ersten Erhebungen vollständig erfasst werden, da mit jedem nicht erhobenen Indikator das Risiko steigt, dass wesentliche Tierwohlprobleme
nicht erkannt werden. Die ausgewählten Indikatoren können dem Tierhalter einen Hinweis auf mögliche Tierschutzprobleme in seinem Bestand geben.
Für die genaue Ermittlung der Ursachen von Auffälligkeiten und die Erarbeitung von Verbesserungsmaßnahmen sollte der bestandsbetreuende Tierarzt oder Spezialberater hinzugezogen werden.
Praxisleitfäden und Werkzeuge für die betriebliche Eigenkontrolle
2016 wurden die ausgewählten Indikatoren als Methodenanleitung für die Praxis ausgearbeitet. Der KTBL Leitfaden „Tierschutzindikatoren – Leitfaden für die Praxis – Rind“ (externer Link) ist eine stalltauglich ausgeführte Arbeitsunterlage für Nutztierhalter und liefert eine Anleitung, wie eine Überprüfung des Tierwohls nach aktuellem wissenschaftlichen Stand praktikabel und fachgerecht durchgeführt werden kann.
Ein Ablaufschema für jede Produktionsrichtung zeigt, welche Indikatoren wann und an welchen Tieren, z. B. an einer beschriebenen Stichprobe, erhoben werden sollten. Ein Steckbrief zu jedem Indikator enthält eine kurze fachliche Erläuterung, eine Foto-Klassifikationstabelle bzw. Rechen-formel sowie weitere Hinweise zur Erhebung.
Verbundprojekts „EiKoTiGer“ (EigenKontrolle TierGerechtheit)
Im Rahmen des vom BMEL geförderten Verbundprojekts „EiKoTiGer“ →EigenKontrolle TierGerechtheit (externer Link) prüften die Projektpartner Thünen-Institut Trenthorst, Friedrich-Loeffler-Institut sowie Universität Kassel die in den Leitfäden beschriebenen Indikatoren und Methoden in je ca. 40 rinderhaltenden Betrieben auf ihre Praxistauglichkeit.
Dabei erhoben die vorab geschulten Tierhalter die Daten eigenständig gemäß Leitfaden, parallel fand eine Datenerhebung durch die EiKoTiGer-Projektpartner statt.
„Tierschutzindikatoren – Leitfaden für die Praxis – Rind“
Basierend auf diesen und anderen Praxiserfahrungen wurde der Leitfaden grundlegend überarbeitet und ist in der 2020 veröffentlichten 2. Auflage noch besser auf das Erkennen möglicher Tierwohlprobleme abgestimmt.
Der Leitfaden ist ein Vorschlag, wie Halter von Rindern in einer betrieblichen Eigenkontrolle – anhand von meist tierbezogenen Kenngrößen – systematisch überprüfen können, wie es um das Tierwohl im eigenen Bestand bestellt ist.
(externer Link)
(externer Link)
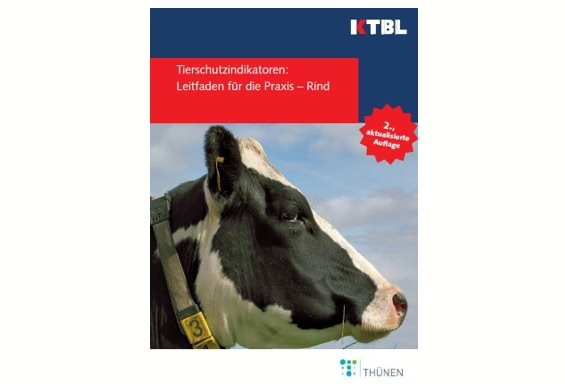
Excel-Datei zur Tierschutzindikatoren-Erhebung

Als ergänzende Werkzeuge gibt es auf der KTBL-Website für die Datenerhebung und -verrechnung gemäß Leitfaden eine Excel-Anwendung („Tierschutzindikatoren-Erhebung“, EiKoTiGer-Projektkonsortium 2020).
(externer Link)
(externer Link)
Mit der Excel-Anwendung für Windows können Tierschutzindikatoren gemäß den Methoden der KTBL-Praxisleitfäden (2., aktualisierte Auflage) erhoben, verrechnet und dokumentiert werden. In den maßgeschneiderten, auch ausdruckbaren, Formularen können Nutztierhalter die Tierschutzindikatoren in ihrem Betrieb erheben. Die Anwendung errechnet die Ergebnisse automatisiert und fasst diese übersichtlich zusammen.
Online-Schulung zur Erhebung von Tierschutzindikatoren für Tierhalter & andere Interessierte
Eine auf die KTBL-Leitfäden zugeschnittene Online-Schulung mit vielen Fotos und Videos sowie Übungs- und Testaufgaben bietet die ab Frühjahr 2021 auf der KTBL-Website frei verfügbare Online- Schulung „Tierschutzindikatoren“.
Sie möchten selbst Tierschutzindikatoren aus dem Leitfaden für die Praxis: Rind, Schwein und Geflügel erheben? In unserer maßge-schneiderten Online-Schulung lernen Sie die Tierschutzindikatoren für die Tierarten Rind, Schwein, Huhn oder Pute kennen und erfahren, wie Sie diese im Praxisalltag für die betriebliche Eigenkontrolle nutzen können. Anschließend können Sie Ihre erworbenen Kenntnisse für die jeweilige Produktionsrichtung anhand von Fotos und Videos in einem Online-Test prüfen und sich, je nach Ergebnis, ein Zertifikat ausstellen lassen.
Die Schulung wurde im Rahmen des Projektes EiKoTiGer gemeinsam von Thünen-Institut, Friedrich-Loeffler-Institut, Universität Kassel und KTBL erarbeitet.
Sie ist angepasst an die 2020 erschienene 2. Auflage der Leitfäden „Tierschutzindikatoren“ und steht kostenfrei zur Verfügung.
(externer Link)
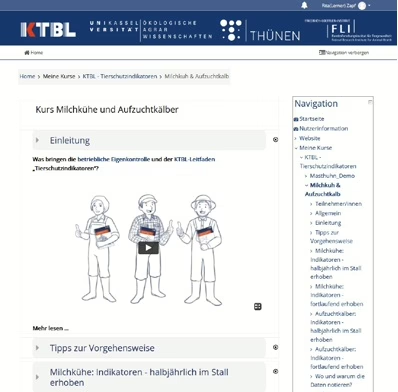
Ziel- und Alarmwerte für die eigenständige Einordnung der Betriebsdaten
Im Projekt „EiKoTiGer“ wurde darüber hinaus für jede Produktionsrichtung ein Orientierungsrahmen mit Ziel- und Alarmwerten als Handreichung für interessierte Tierhalter erarbeitet, um ihre selbst erhobenen Daten einzuordnen. Anhand dieser Ziel- und Alarmwerte, die in einem mehrstufigen Ab-stimmungsprozess unter Einbeziehung aller relevanten Akteursgruppen erarbeitet wurden, können Tierhalter eigenständig ableiten, ob die Tierwohl-situation bereits „im grünen Bereich“ liegt oder ob mittel- bzw. kurzfristig Handlungsbedarf (Frühwarn- bzw. Alarmbereich) zur Verbesserung der be-trieblichen Tierwohlsituation besteht (EiKoTiGer-Projektkonsortium 2021). Eine solche Bewertung ist gemäß § 11 Abs. 8 (TierSchG) erforderlich.

Die Ziel- und Alarmwerte wurden 2020 auf der KTBL-Website veröffentlicht und können kostenlos heruntergeladen werden.
(externer Link)
Um über die Ziele und den Inhalt der Leitfäden, der Ziel- und Alarmwerte sowie weiteren Angebote zu informieren und größtmögliche Akzeptanz in der Praxis und Beratung zu erreichen, fanden Informationsgespräche mit den Tierschutzreferenten des Bundes und der Länder 2016 und 2020, mit den Vertretern der verschiedenen Erzeugerverbände für Rind, Schwein, Geflügel und dem Deutschen Bauernverband im Juni und Dezember 2016 sowie im Dezember 2020 statt.
Delegieren ist möglich, Dokumentieren ist sinnvoll
Die Indikatoren wurden von Experten hinsichtlich ihrer Eignung für eine Überprüfung des Tierwohls zur Verbesserung des betrieblichen Managements für Nutztierhalter ausgewählt. Zwar hat es Vorteile, wenn der Tierhalter selbst die Erhebungen der Indikatoren durchführt, aber es besteht ebenso die Möglichkeit, dies Dritten zu überlassen, z. B. betrieblichen Beratern oder bestandsbetreuenden Tierärzten. Sinnvoll ist ein solches Outsourcing aber natürlich nur, wenn der Rückfluss der Informationen zum Tierhalter gewährleistet ist.
Damit negative Entwicklungen im Tierbestand abgestellt und positive Maßnahmen beibehalten werden, empfiehlt es sich, eine systematische und regelmäßige Erfassung und Bewertung der Tierwohlsituation im eigenen Bestand als Gegenstand des laufenden Betriebsmanagements zu etablieren.
Was von vielen Betrieben schon praktiziert wird, ist die systematische Erhebung bestimmter Messgrößen – wie Futter- und Wasserverbrauch, Leistungs- und Gesundheitsdaten, Tierverluste – und deren Nutzung für die täglichen betrieblichen Managemententscheidungen. Effizient ist eine entsprechende Einbindung von mehr Tierwohlindikatoren ins betriebliche Datenmanagement, insbesondere auch in computergestützte Managementhilfen.
Erst wenn der Tierhalter die Ergebnisse seiner betrieblichen Eigenkontrolle dokumentiert, ist eine betriebliche Schwachstellenanalyse zielführend. Denn nur so kann er Veränderungen über die Zeit und die Wirkung der von ihm ergriffenen Maßnahmen auf seinen Tierbestand längerfristig beurteilen. Dies macht auch einen der wesentlichen Unterschiede zu den täglichen Tierkontrollen aus, bei denen es vornehmlich um die Einleitung von Sofort-maßnahmen geht, z. B. bei Erkrankungen von Tieren, zu hohen Stalltemperaturen. Die betriebsinterne Dokumentation kann dem Tierhalter zusätzlich als Nachweis seiner Umsetzung des § 11 Abs. 8 (TierSchG 2006) gegenüber den zuständigen Behörden dienen.
Fazit

Zur Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen, betrieblichen Eigenkontrolle, hat der Gesetzgeber keine weiteren Vorgaben gemacht. Das KTBL hat gemeinsam mit Experten verschiedener Akteursgruppen und insbesondere seinen Projektpartnern, dem Thünen-Institut, dem Friedrich-Loeffler-Institut und der Universität Kassel Werkzeuge erarbeitet, die für eine Eigenkontrolle genutzt werden können.
Die Praxisleitfäden für die betriebliche Eigenkontrolle sind Expertenempfehlungen und sollen dem Tierhalter zur Schwachstellenanalyse und Optimierung des betrieblichen Managements dienen. Gleichzeitig stellen sie eine fachlich fundierte und praxiserprobte Möglichkeit dar, der Eigenkontrollpflicht nach § 11 Abs. 8 TierSchG nachzukommen. Mit den weiteren Angeboten wie Online-Schulung, Excel-Anwendung zur
Datenerhebung sowie Orientierungsrahmen als Bewertungshilfe stehen Tierhaltern die wesentlichen Werkzeuge für die Durchführung einer betrieblichen Eigenkontrolle zur Verfügung.Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.V. (KTBL) https://www.ktbl.de/ (externer Link)
